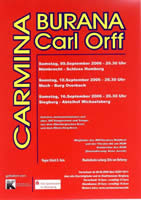|
> Unsere Produktionen > "Carmina burana" "Carmina burana" von Carl OrffCo-Produktion mit dem Sängerkreis
Oberbergisch' Land und der Mucher Konzertgemeinschaft,
gefördert u. a. vom Ministerpräsidenten des Landes
Nordrhein-Westfalen und der Kulturstiftung der
Kreissparkasse Köln. Premiere war am Samstag, 09.09.2006 in Nümbrecht (Schloss Homburg); weitere Vorstellungen: 10.09.2006 in Much (Burg Overbach) und 16.09.2006 in Siegburg (Abtei Michaelsberg). |
|
Zur
musikalischen Konzeption dieser Aufführung Aufgrund der kompositorischen Struktur der Chöre ist in unserer Aufführung der Gesamtchor in drei Gruppen geteilt: Ein Kleinchor singt die beiden kammermusikalischen Chöre der Nummern 3 und 19 und ein aus weit über hundert Sängerinnen und Sängern bestehender Favoritchor singt alle übrigen Chöre. Bei den großen und gewichtigen Rahmenchöre des Werkes vereint sich dieser Favoritchor mit einem Tuttichor aus weiteren ca. 200 Sängerinnen und Sängern, um die Klanggewalt dieser Stücke deutlich werden zu lassen. Das musikalisch Besondere
unserer Aufführung besteht im Einschub zweier Teile mit
Musik aus dem mittelalterlichen „Codex Buranus“, die ich
eigens für diese Aufführung nach den Neumen des „Codex
Buranus“ und Vergleichshandschriften rekonstruiert und für
das Frauenvokalensemble A CAPPELLA, KÖLN eingerichtet habe.
Der erste Einschub erklingt nach den Frühlingsliedern der
Orffschen „Carmina Burana“ und führt diese mit
mittelalterlichen Frühlings- und Liebesliedern fort. Der
zweite Einschub setzt die Wirtshausszene mit ihrem
unheiligen Treiben fort. Es handelt sich um eine für dieses
Projekt eingerichtete Kurzfassung des „Officium lusorum“
(„Spielermesse“) der mittelalterlichen Handschrift. Bei
dieser „Spielermesse“ handelt es sich um ein parodistisch
verfremdetes Messformular. Als Vorlage dienten dem
mittelalterlichen Komponisten unterschiedliche bekannte
Perikopen bzw. Gesangsstücke des gregorianischen Repertoires
(z.B. der Introitus „Gaudeamus“ des Allerheiligenfestes oder
die Ostersequenz „Victimae paschali laudes“). Dabei sollte
nicht der parodierte Text ironisiert werden. Vielmehr stand
die Lust am Wortwitz im Vordergrund, vielleicht auch die
satirische Darstellung des gottlosen Treibens in
Wirtshäusern, bei denen das Würfelspiel zum Allerheiligsten
wird. Der mittelalterliche Höhepunkt der Messe mit der
Konsekration ist im „Officium lusorum“ wohl auch deshalb
nicht enthalten, weil man sich nicht über die Sache als
solche lustig machen wollte, sondern lediglich über deren
Auswüchse. Vom “Codex Buranus”
zur “Carmina Burana” von Carl Orff Nach der Säkularisation kam die Handschrift in die Bayerische Staatsbibliothek München. Ihr Text wurde 1847 von Johann Andreas Schmeller erstmals komplett herausgegeben. Diese Ausgabe fiel Carl Orff zufällig in die Hände. Für die Komposition seiner „Carmina Burana“ („Benediktbeurer Lieder“) wählte er Dichtungen aus dem „Codex Buranus“ aus und stellte sie neu zusammen. Das zentrale Thema seiner Komposition ist das Schicksal, verkörpert in der Göttin Fortuna, das die Menschheit in seiner Hand hält und wahllos mit ihr spielt, indem Glück und Unglück sinnlos den Menschen treffen. Diese Weltsicht hat bei Orff die fatalistische Konsequenz: Genieße das Leben in vollen Zügen, denn das Unglück kann schneller kommen, als du denkst! So bildet das „Schicksalslied“ O Fortuna die kompositorische Klammer, unter der Frühlingsgefühle (Primo vere), Zechgelage (In taberna) und Liebeszauber (Cour d´amours) die Freuden des Menschseins darstellen, die vom Schicksal morgen schon zunichte gemacht werden können. Die Musik von Orffs „Carmina Burana“ hat nichts mit den mittelalterlichen Melodien des „Codex Buranus“ zu tun, nur in der Nr. 9 verwendet Orff im Chum geselle min eine Melodie, die sich schon bei Adam de la Hale im 13. Jahrhundert zu diesem Text findet. Die Orffsche Melodik ist einfach und oft strophisch gegliedert, die Harmonik ist blockhaft, ostinatohaft und ohne Entwicklung. Das ganze Werk ist stark rhythmisch geprägt. Durch das oftmalige Gegeneinandersetzen von Frauen- und Männerchor und durch die häufige Oktavkoppelungen zwischen Frauen- und Männerstimmen entsteht ein archaischer Eindruck. Die Nazis sagten dem Werk
bei seiner Uraufführung 1937 keinen großen Erfolg voraus.
Heute ist es das am häufigsten aufgeführte oratorische
Chorwerk überhaupt. Carf Orffs CARMINA
BURANA in Szene setzen Während üblicherweise versucht wird, das Gehörte sozusagen in eine optische 1:1-Übersetzung umzusetzen, wollen wir hier eine Rahmenhandlung schaffen. Alles, was zu hören und zu sehen ist, ist die innere Welt eines Dichters. Das Publikum nimmt gleichsam Teil am inneren Erleben des Dichters. Und dieses Erleben ist geprägt von der individuellen Sicht Carl Orffs, wie sie in der Carmina Burana deutlich wird (vergl. dazu den Artikel van Betterays oben zum Codex Buranus und der Auswahl Orffs hin zur Carmina Burana). Orffs fatalistisch schicksalsergebene Sicht findet ihre Entsprechung in der depressiven Rückschau des Dichters auf die Freuden des früheren Lebens, der erfüllt ist vom mittelalterlichen und barocken Gedanken des carpe diem („Lebe den Tag, weil du ja doch bald sterben wirst und alles Streben umsonst ist.“). Der Dichter sieht die Bilder und Sinnbilder (Allegorien) des Lebens aus seiner Sicht, aber der Zuschauer sieht diese Bilder sozusagen neutral. Der Zuschauer sieht den Dichter und die Bilder, sieht die Bilder nicht aus der Sicht des Dichters und kann selber entscheiden, wie er die Texte, die hier vertont erklingen, verstehen will und kann. Konsequenterweise sind
deshalb die musikalisch Ausführenden in diesem Konzept
beinahe absolut statisch. Sie geben die Botschaft, - was
damit anzufangen ist, muss der Zuschauer selber entscheiden.
So, wie der Dichter für sich entschieden hat. Und wenn die Allegorie
Fortuna mit den Ebenen des Lebens sozusagen Schach spielt
und damit das menschliche Geschick einem Spiel gleich werden
lässt, dann entspricht das der Sicht des Dichters, der sich
zusätzlicher Verse des Codex Buranus und der moralisch
predigenden Dichtung eines Sebastian Brant (1494) aus seinem
„Narrenschiff“ bedient, um seinen Seelenzustand zu
verdeutlichen. Aber die Tatsache, dass die Allegorien
selbständig werden, verletzlich sind, zeigt, dass sie einem
höheren Gesetz unterworfen sind. Einem Gesetz, dem auch
Fortuna unterworfen ist. Dem Gesetz des Lebens, das mehr ist
als tumbes Schicksal oder reiner Zufall. |
| Weitergehende Informationen: | |
Ankündigung
|
|
Originaltext der
"Carmina burana" und deutsche Übertragung von Dr. Dirk van
Betteray
|
|
Fotogalerie
|
|
|
Presseberichte und Kritiken:
|
|